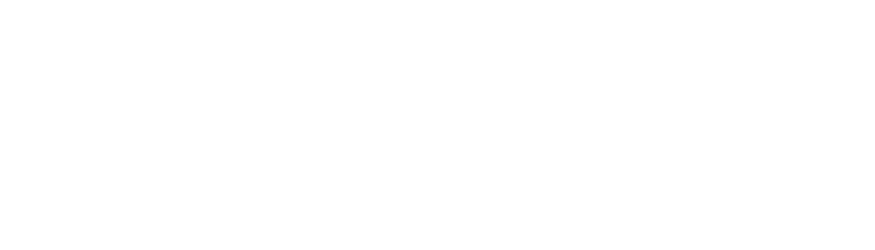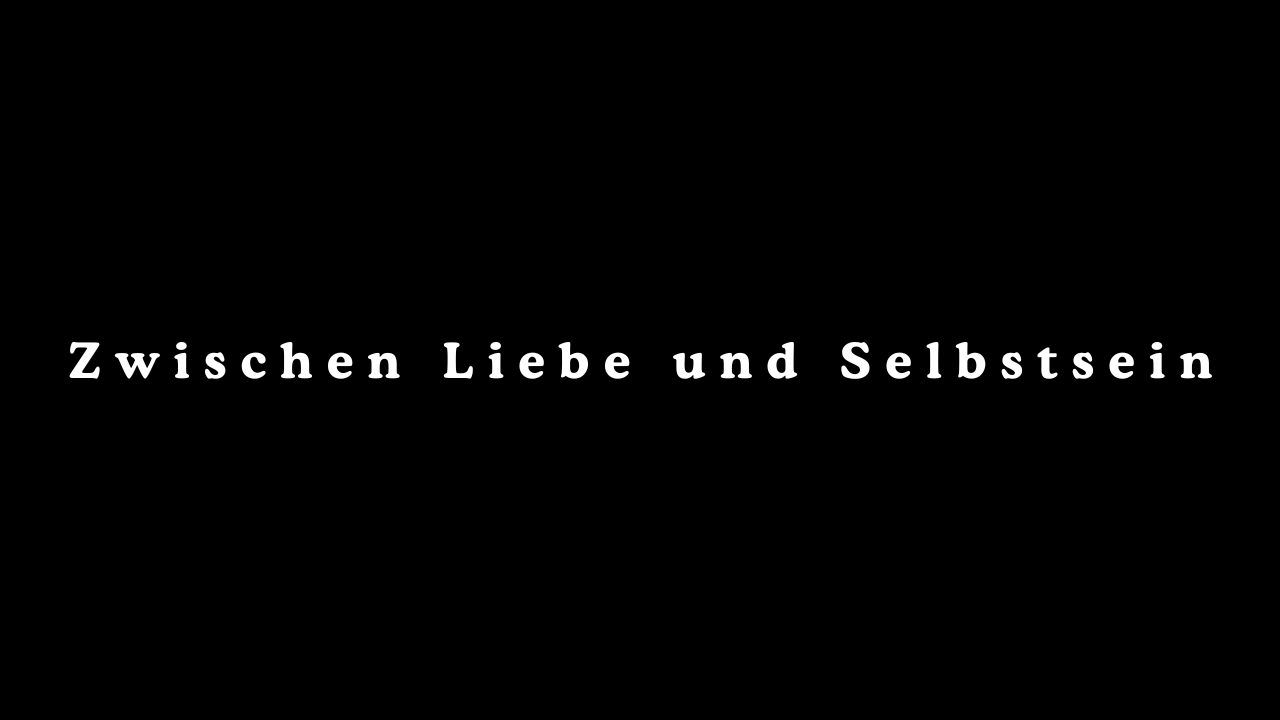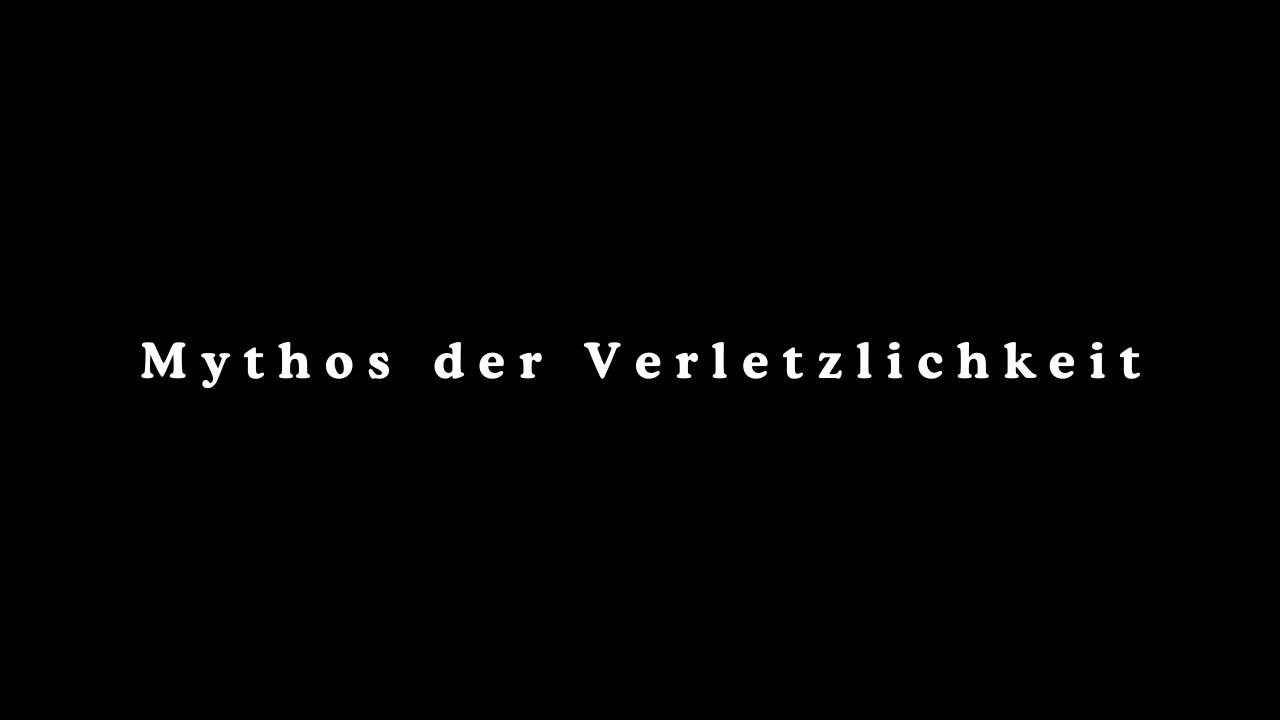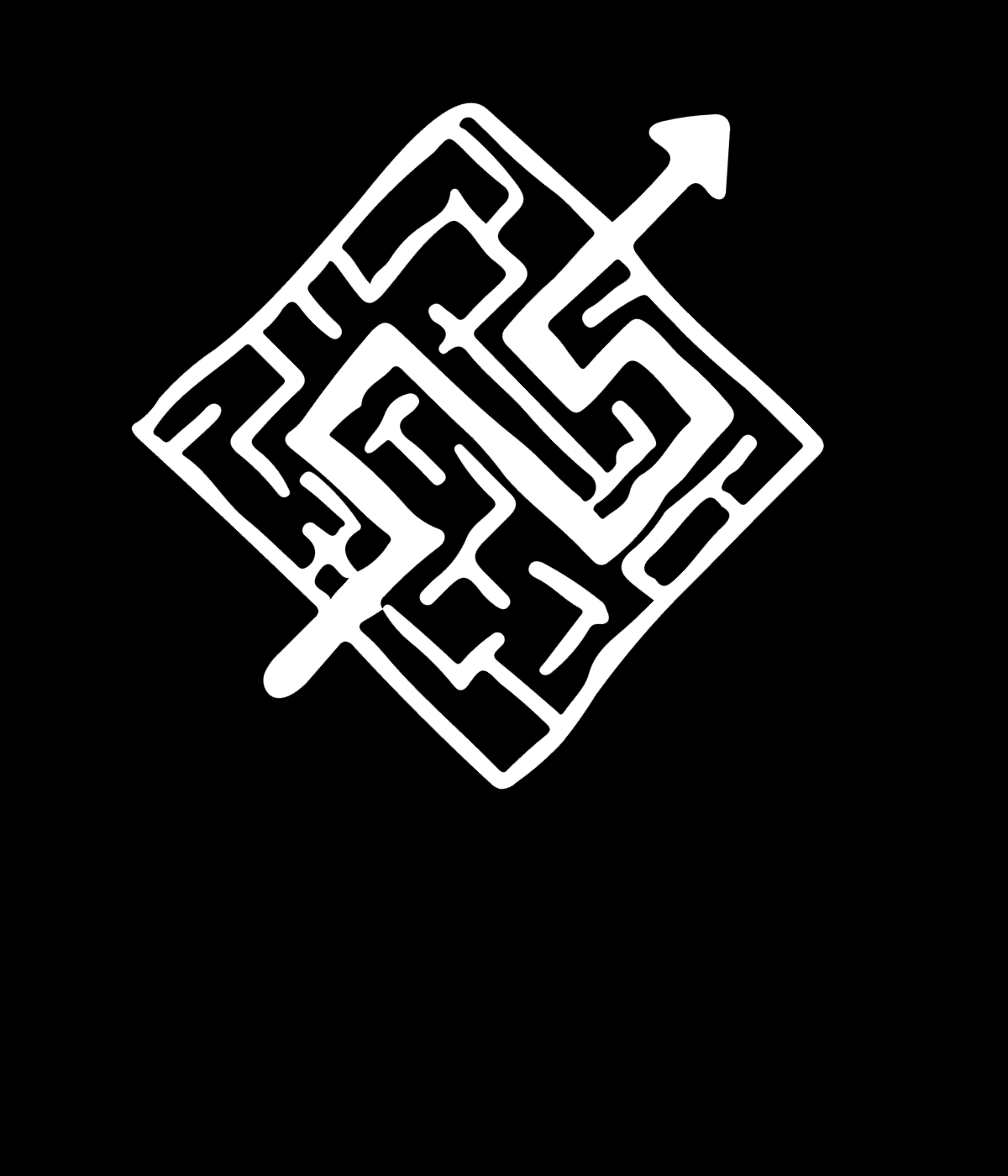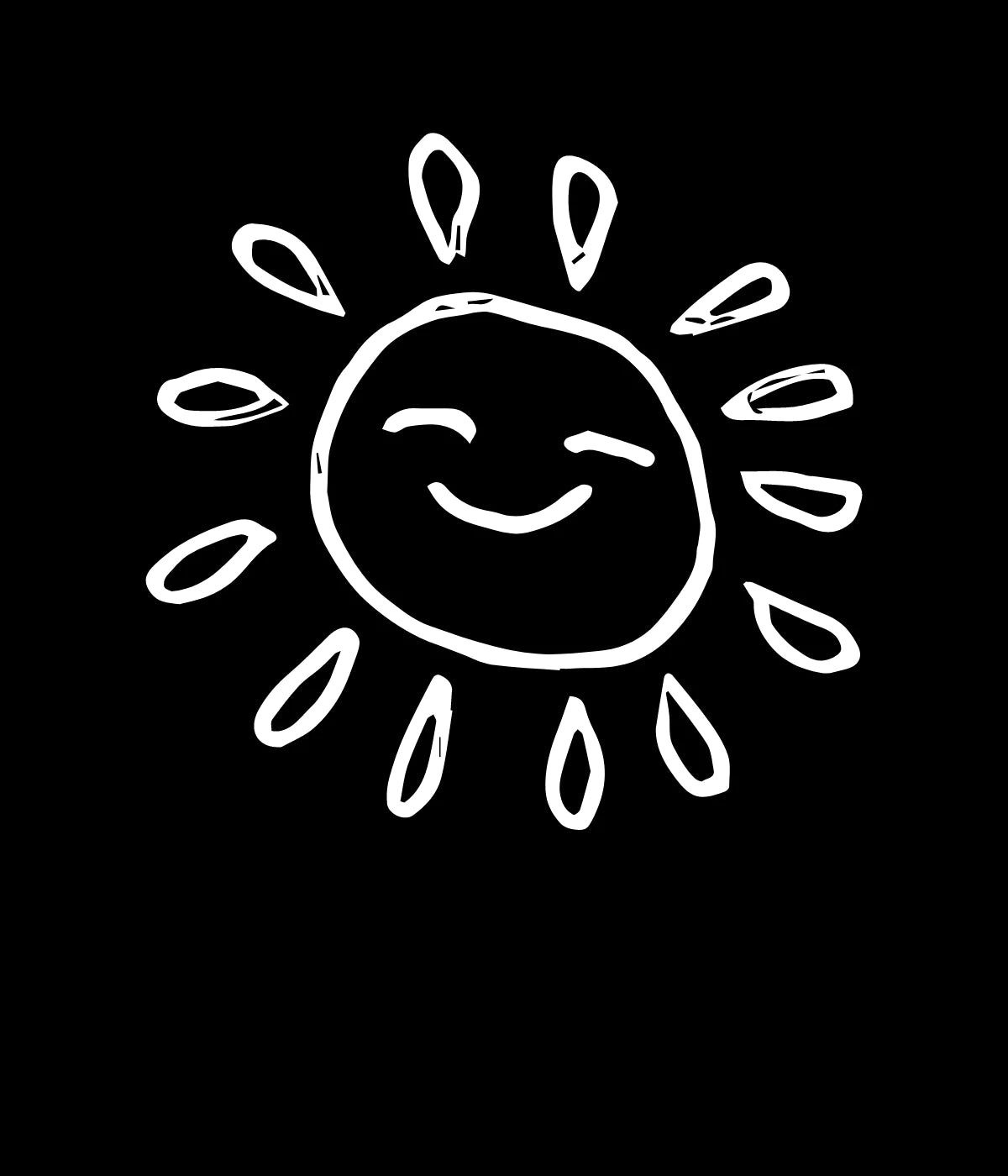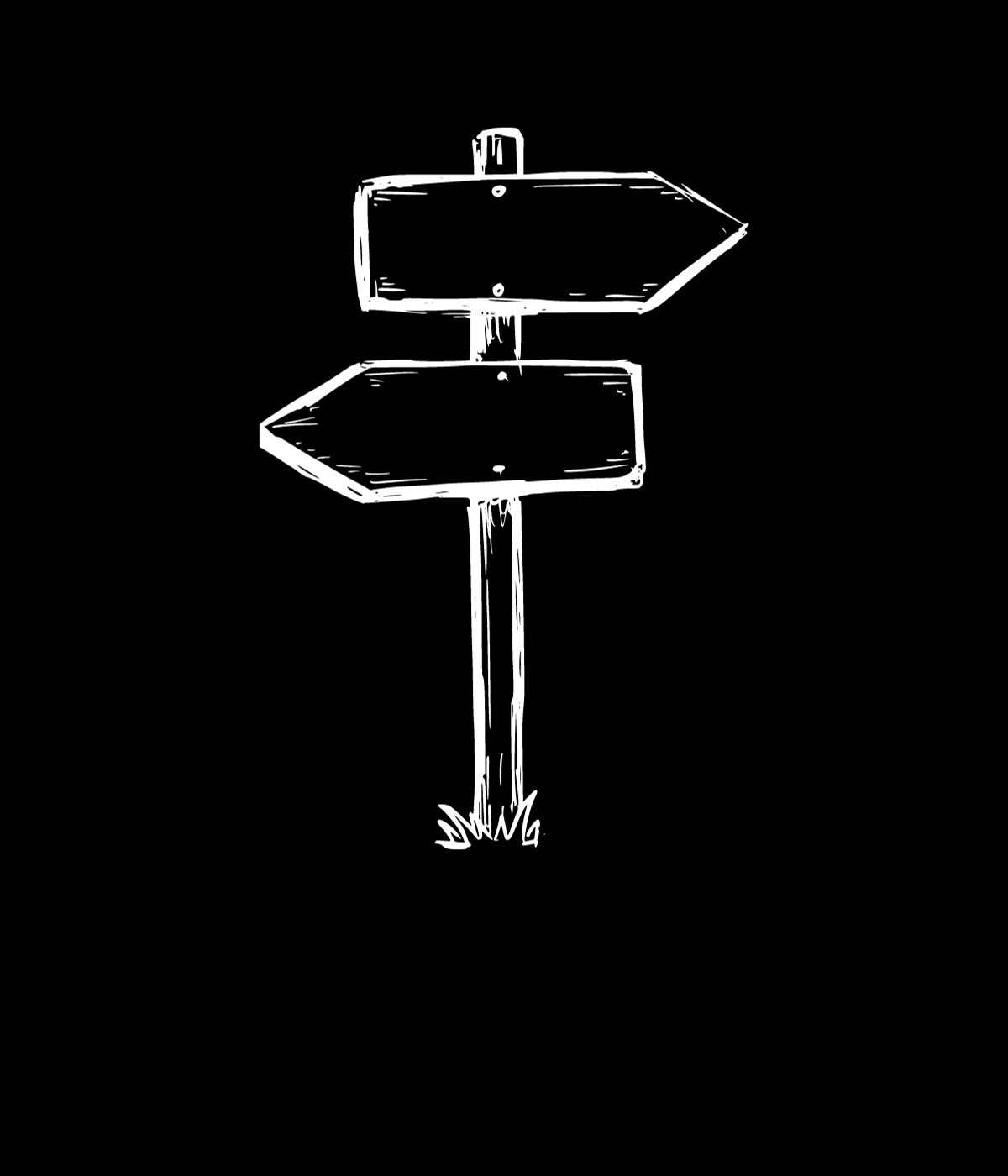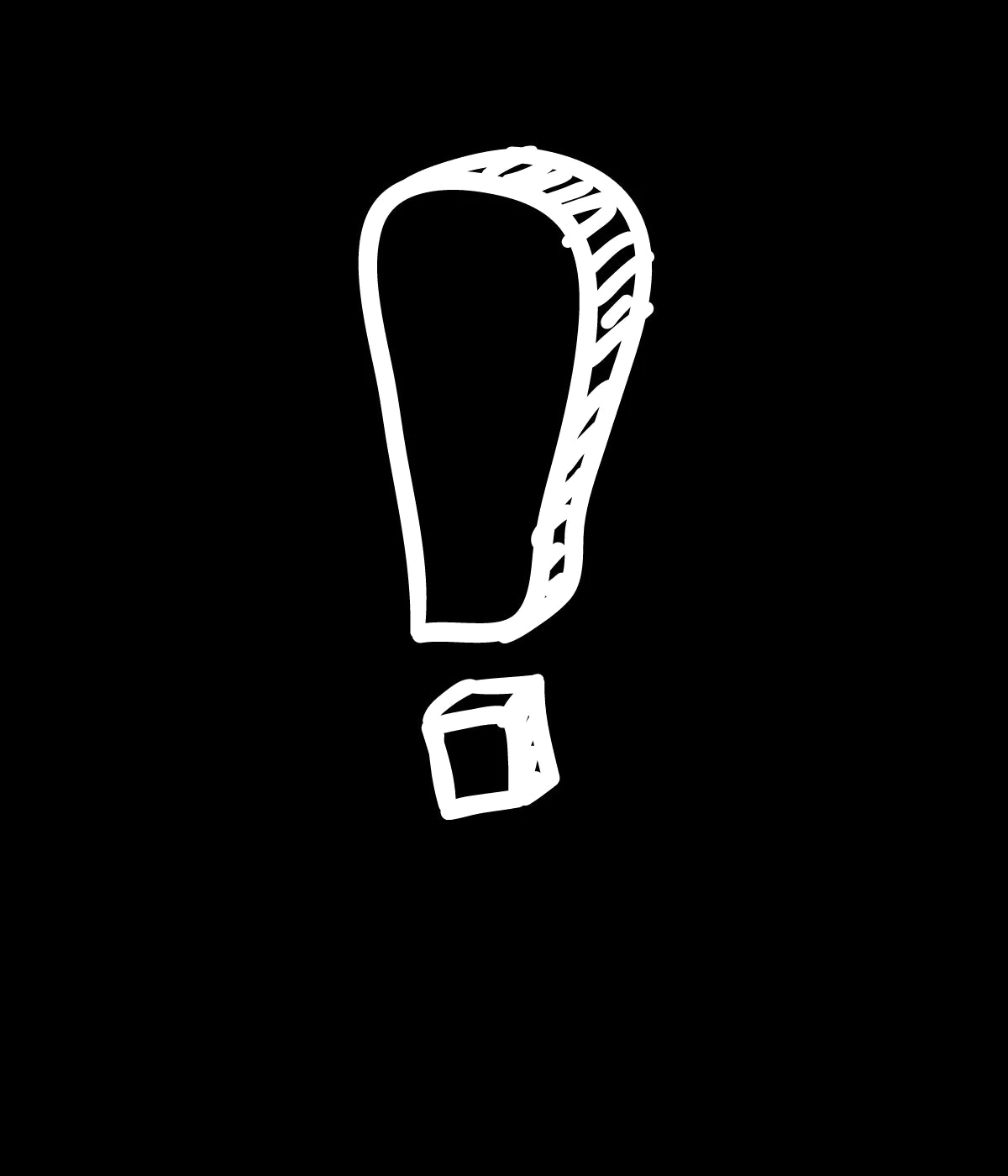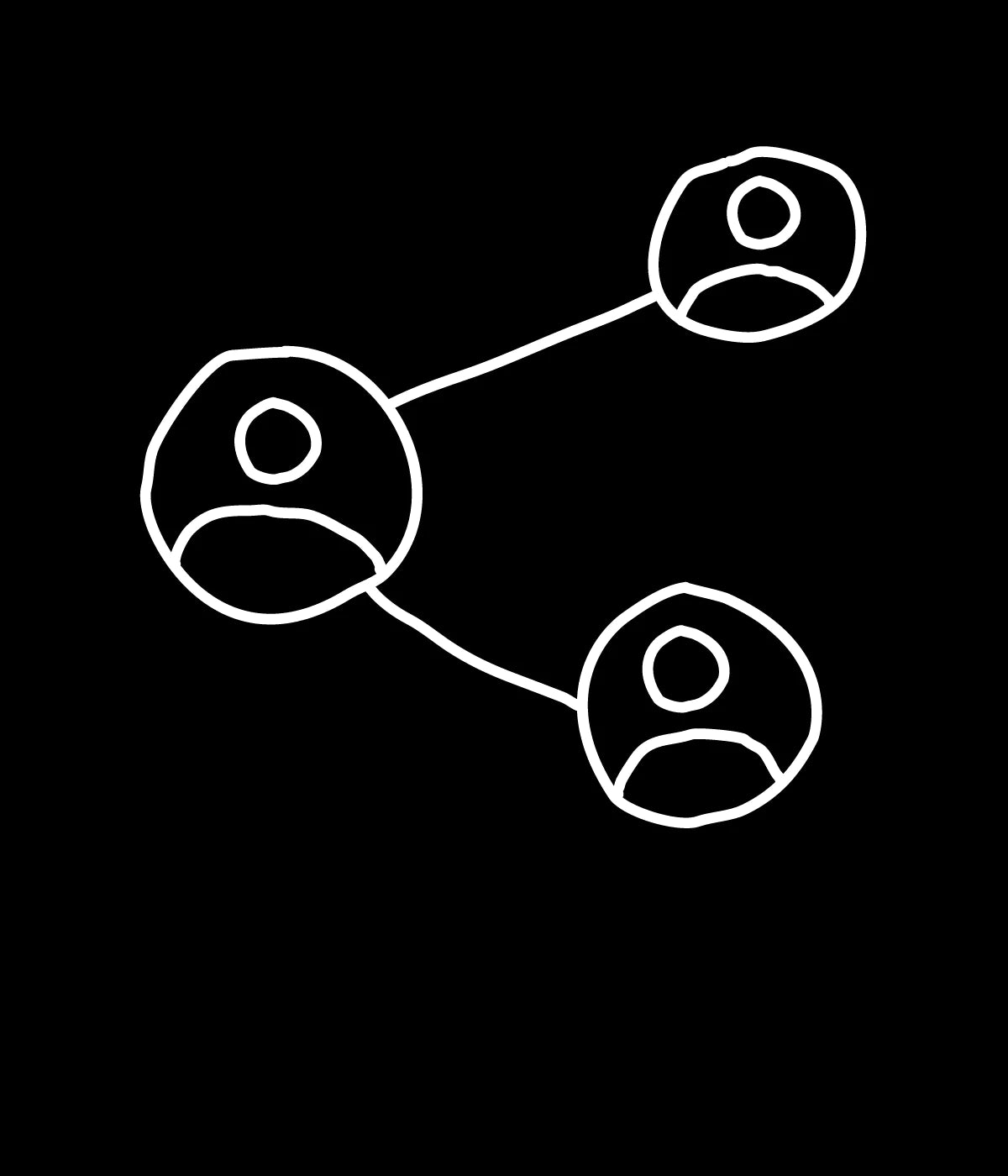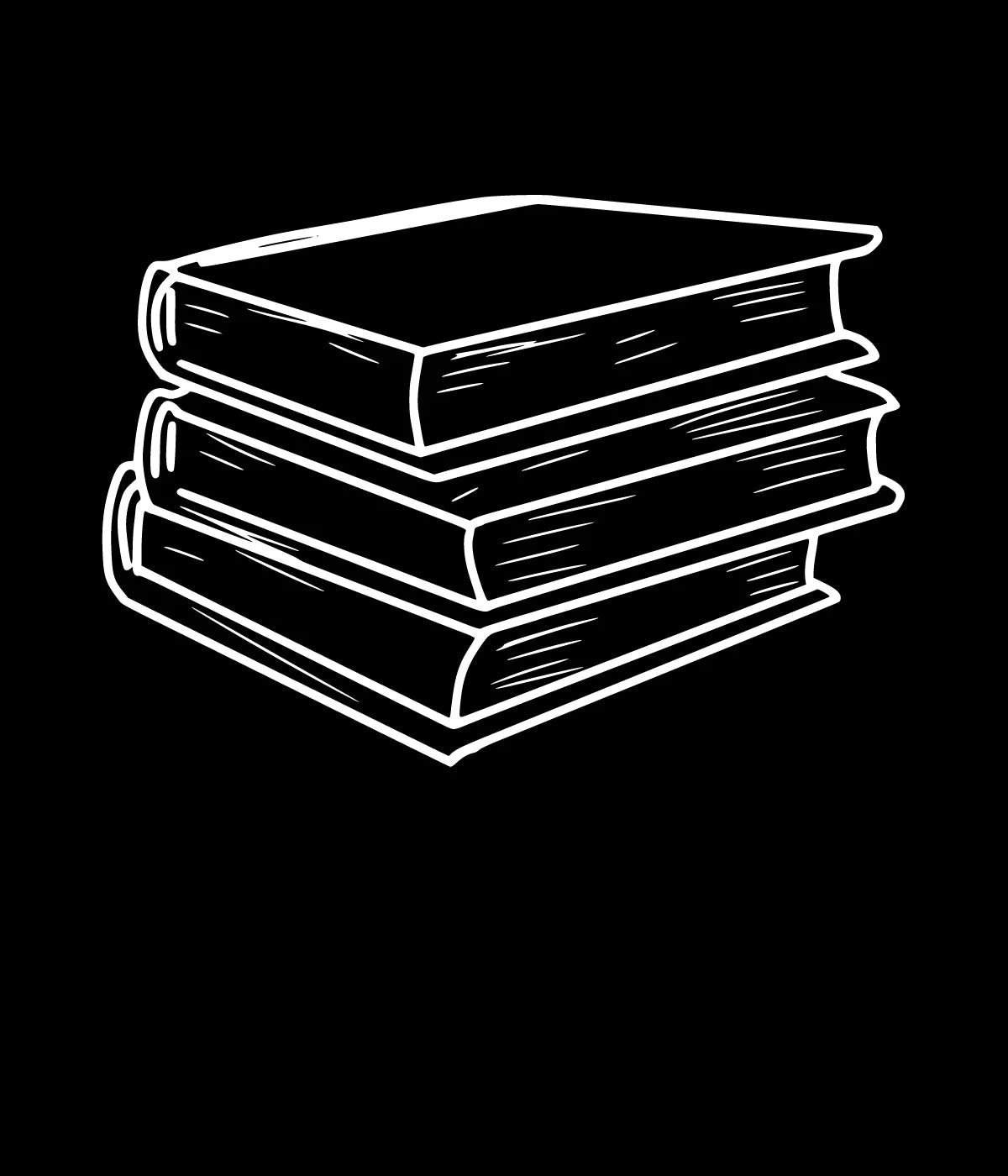Es gibt Momente, in denen man sich selbst verliert – und es gar nicht merkt.
Momente, in denen alles fließt, die Zeit keine Rolle spielt, und man sich einfach fallen lässt.
Die letzten Wochen waren genau das. Intensiv, nah, fast Überwältigend.
Jeder Tag verschmolz mit dem nächsten, zwischen spontanen Ausflügen, langen Gesprächen und dieser unausgesprochenen Magie, wenn zwei Menschen sich wirklich sehen. Jeder Tag mit ihr war ein kleiner Kosmos aus Gesprächen, Berührungen, geteilten Gedanken und Plänen. Ich mochte das. Vielleicht mochte ich es sogar zu sehr.
Es gibt Momente, in denen alles perfekt scheint. Wo sich zwei Menschen aufeinander einlassen, sich in ihrer Nähe verlieren – und genau darin aufgehen.
Aber jetzt sitze ich hier. Shisha an, Kaffee dampft, mein Blick schweift ins Leere. Es ist einer dieser Morgen, an denen man merkt: Irgendwas ist anders.
Von 0 auf 100 – und dann?
Es begann rasant. Ein Kennenlernen, das nicht nur neugierig machte, sondern auch etwas Tiefes, Echtes, Ungefiltertes mit sich brachte. Keine Spielchen, keine Masken. Ich sah sie, sie sah mich – so schien es zumindest.
Plötzlich war sie überall.
Morgens, mittags, abends. Nächte, die im Gespräch verflogen. Stundenlange Autofahrten, Spaziergänge im Wald, gemeinsame Zukunftspläne, die sich wie aus dem Nichts formten.
Und dann dieser Moment:
„Ich liebe dich.“
Und ich? Ich hab’s erwidert. Weil es sich richtig anfühlte.
Aber jetzt frage ich mich:
Fühlte es sich richtig an – oder fühlte es sich einfach gut an?
Diese Frage schlich sich langsam in meinen Kopf. Und dann passierte etwas, das mir zeigte, dass ich sie stellen muss.
Die ersten Risse – oder einfach nur Realität?
Versteh mich nicht falsch – es ist nichts passiert.
Kein Streit, kein Drama. Aber irgendwas hat sich verschoben.
Vielleicht ist es nur das natürliche Pendeln zwischen Nähe und Distanz, das jede Beziehung irgendwann durchläuft. Vielleicht ist es auch mehr.
Es sind die kleinen Dinge.
Wie dieser eine Abend bei meinen Eltern...
Wir waren den ganzen Tag zusammen, und abends hieß es:
„Meine Eltern machen nachher die Sauna an. - Oh cool, lass uns doch hinfahren, ich war schon seit zwei Wochen nicht mehr in der Sauna!“
Es war ein lockerer Vorschlag – aber im Grunde hatte sie sich bereits selbst eingeladen. Nicht, dass es mich störte. Im Gegenteil: Es gab mir das Gefühl, dass sie sich in meine Familie einfügen wollte.
Also gut. Nach einem entspannten Nachmittag mit meiner Teenie-Schwester, One Piece auf der Couch und einem guten Essen fuhren wir gemeinsam zu meinen Eltern.
Und dann geschah etwas Unerwartetes.
Es war das erste Mal, dass sie mein Elternhaus betrat. Für mich in dem Moment: Nichts wirklich Besonderes.
Für sie: Ein bedeutender Moment.
Ich dachte, sie würde sich einfach umschauen, sich wohlfühlen. Stattdessen wartete sie darauf, dass ich ihr mein Zuhause zeige, sie an die Hand nehme, sie in diesen Teil meines Lebens einführe.
Ich merkte es nicht. Ich führte sie nicht herum. Ich ließ sie einfach machen – nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil mir nicht bewusst war, dass sie genau das von mir erwartete.
Und dann waren wir in der Sauna.
Später unter der Dusche.
Ihr Körper rieb sich an meinem, ihre Stimme leise:
„Wie fühlt es sich an, mit einer Frau dort zu sein, wo du aufgewachsen bist?“
Und ich? Ich habe es in dem Moment nicht einmal realisiert.
Später saßen wir wieder bei meinen Eltern auf der Couch. Sie wollte noch in den Wald – ein Nachtspaziergang unter dem Vollmond. Ich genoss den Moment mit meiner Familie.
Sie fragte einmal. Zweimal.
Ich nahm es nicht wahr.
Dann gingen wir doch noch in den Wald.
Aber der Mond war bereits weitergezogen, das Licht gedämpft.
Sie war genervt. Ich verstand es erst später.
Und während wir liefen, merkte ich:
Ich hinterfrage gerade alles.
Hat sie sich vielleicht in mir getäuscht?
Oder bin ich derjenige, der sich selbst nicht mehr richtig sieht?
Habe ich mich in ihr getäuscht?
Warum fühlt sich etwas plötzlich… anders an?
Doch dann kam das Gespräch.
Offen. Ehrlich. Ungefiltert.
Wir sprachen über Erwartungen, über Wahrnehmung, über diesen ganzen Prozess, sich in jemanden hineinzufühlen.
Und in diesem Moment wurde mir klar:
Wir sind beide noch dabei, zu verstehen, was es bedeutet, wirklich füreinander da zu sein.
Die Kunstausstellung
Gestern Abend dann ein ganz anderes Bild.
Wir fuhren gemeinsam zu einer Kunstausstellung, eine Vernissage von einer Freundin von ihr. Ihre Leute waren da, sie stellte mich vor – alles schien gut.
Bis sie auf einmal verschwunden war.
Kein Abschied, ein kurzes „Mir ging's nicht gut.“ Einfach weg.
Ich stand da, alleine zwischen fremden Gesichtern, betrachtete Kunstwerke, während meine Gedanken ratterten:
Warum ist sie gegangen? Habe ich etwas verpasst?
Später schrieb sie mir:
„Es ging mir nicht gut, ich wollte um Hilfe bitten, aber ich habe mich nicht getraut.“
Das war der Moment, in dem ich es verstand.
Sie will unabhängig sein.
Aber kann man echte Nähe überhaupt mit Unabhängigkeit messen?
Sie will nicht „die Frau sein, die von ihrem Freund nach Hause gefahren wird“.
Selbst wenn es ihr schlecht geht, kämpft sie mit sich selbst, anstatt einfach zu sagen: „Hey, mir geht’s nicht gut, lass uns fahren.“
Aber ist das wirklich Unabhängigkeit – oder ist es Angst, sich an jemanden anzulehnen?
Und wenn ich ehrlich bin: Mache ich nicht genau dasselbe?
Liebe ich sie – oder liebe ich es, gebraucht zu werden?
Die letzten Wochen waren intensiv, wunderschön, lehrreich. Aber auch herausfordernd.
Ich merke, dass ich mich selbst infrage stelle.
Liebe ich sie – oder liebe ich das Gefühl, gebraucht zu werden?
Ich merke, dass ich oft funktioniere, anstatt bewusst zu entscheiden.
Ich sage „ja“, auch wenn ich vielleicht „nein“ meine.
Ich nehme Rücksicht, anstatt klar zu sagen, was ich brauche.
Und dann frage ich mich:
Brauche ich diese Nähe, weil ich mich selbst darin wiederfinde?
Oder ist es die Angst, mich in der Distanz zu verlieren?
Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.
Doch was bedeutet es, jemanden zu lieben, ohne sich selbst aufzugeben?
Wie viel Nähe ist gut – und wann wird sie zur Last?
Vielleicht ist Liebe nicht die Frage nach Nähe oder Distanz – sondern die Kunst, beides gleichzeitig zu halten. Vielleicht geht es nicht darum, sich zu verlieren oder festzuhalten, sondern gemeinsam herauszufinden, wo man wirklich stehen will.
Was denkst du?
Hast du diese Dynamik auch schon erlebt? Wie balancierst du Nähe und Freiheit in einer Beziehung?
Vielleicht schreibe ich das hier, um es für mich selbst zu ordnen. Vielleicht, um herauszufinden, ob andere diese Dynamiken auch kennen.
Vielleicht einfach nur, weil es in mir arbeitet. Falls du ähnliche Gedanken hast, lass es mich wissen.